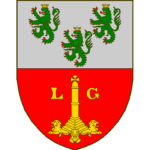Lexikonsaktion und Grandmaison
So, als Arbeitstitel für diesen Beitrag, hatte ich mir den folgenden Satz ausgedacht: Lexikonaktion wieder aufgenommen und Digitalisierungsprojekt “Grandmaison” angegangen Das ist für einen Blogbeitrag aber zu lang. Bis Mitte Juni beschäftigte ich mich in meiner Freizeit, abgesehen von Urlauben, Haushaltsarbeiten etc. und Radfahren (!), fast ausschliesslich mit dem AVLhistory Projekt zur 125 Jahrfeier des […]


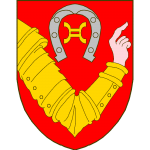

![Burelé d'argent et d'azur au lion de gueules à la queue fourchée [et passée en sautoir,armé,lampassé et] couronné d'or brochant sur le tout.](http://www.wiesel.lu/wp-content/uploads/2013/09/luxembourg-belge-150x150.png)