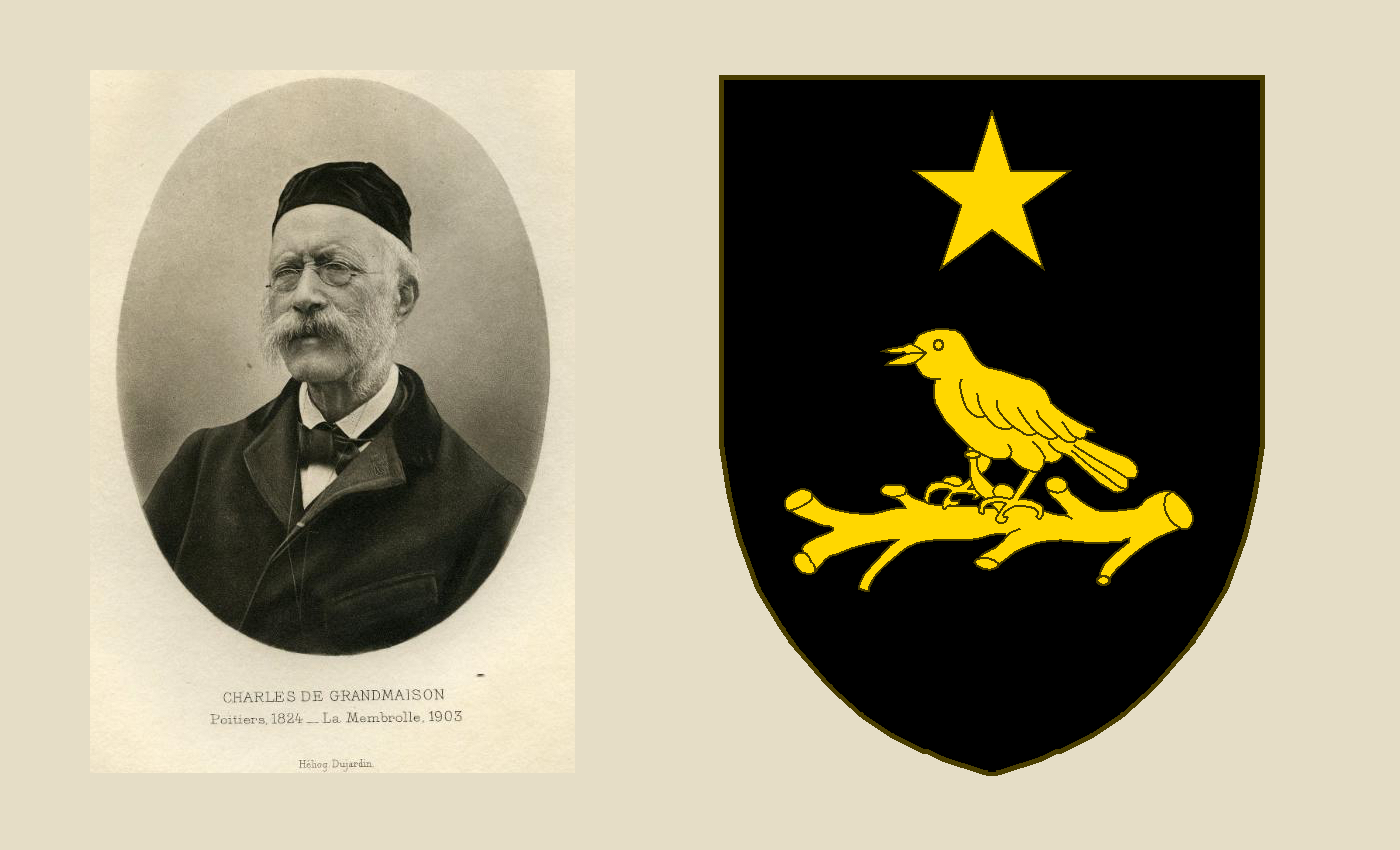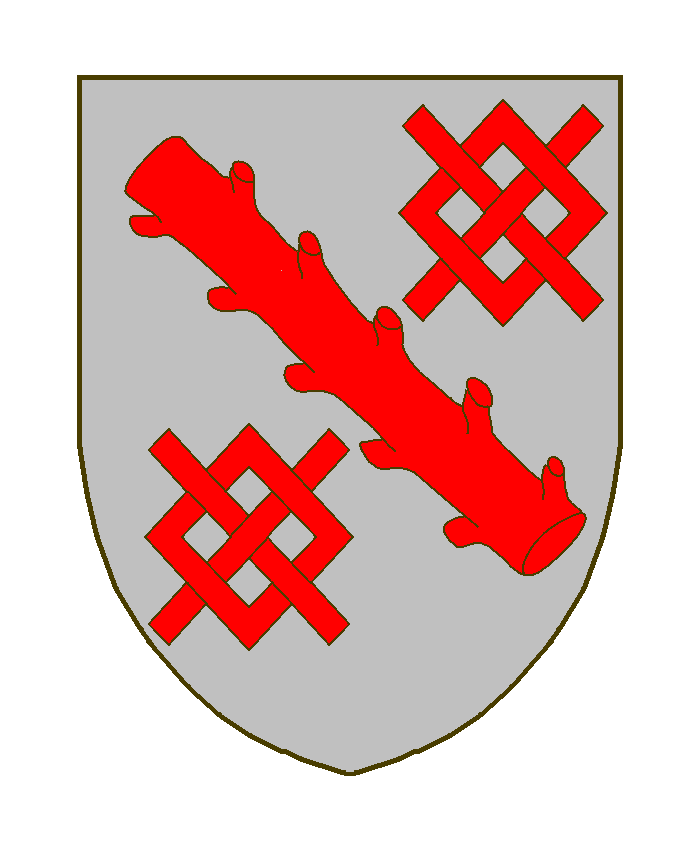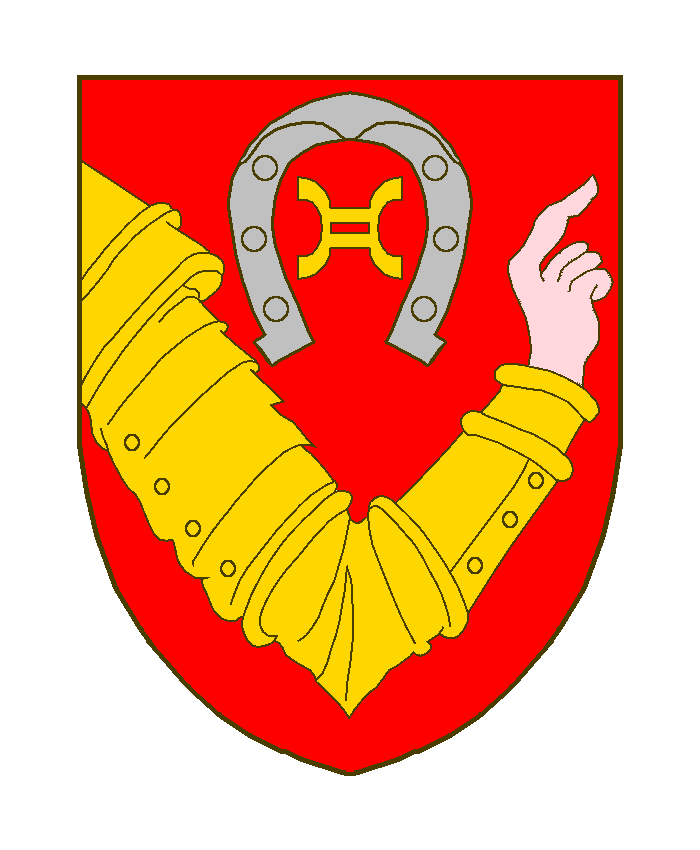Zu wenig Aktivität => Habe wieder eine statische Frontpage
Leider musste ich festgestellen, dass ich seit einiger Zeit praktisch nichts mehr hier schreibe und deshalb wie schon vor fünf Jahren eine statische Frontpage eingestellt. Diesmal ist es besonders schlimm, ich war fast ein Jahr still. Gründe dafür gibt es viele, öffentlich drauf eingehen möchte ich aber nicht. Alle meine Projekte litten! Gerade auch Critical … Read more